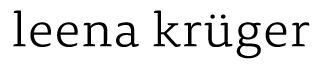Einführungstext
„Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst und man verknüpft sich nicht sicherer als durch die Kunst.“
Goethe, Wahlverwandtschaften
Unterschiedlicher als die malerischen Werke von Ursula Krämer und Leena Krüger könnten Bilder von zwei Künstlerinnen kaum ausfallen. Dennoch haben sie in einer gemeinsamen Ausstellung, überschrieben mit dem Titel „Wahlverwandtschaften“, die Begegnung ihrer Kunstpositionen selbst forciert.
Stilistische Familienähnlichkeit in der Handschrift der Künstlerinnen kann dabei als Grund ausgeschlossen werden – zu eigenwillig der lagenschwere, in ferne Tiefe gestaffelte Farbauftrag der einen, zu konsequent direkt der locker auflösende Pinselstrich der anderen.
Dennoch reichen sich die Werke der so verschieden agierenden Künstlerinnen, in deren Kunst weder Motiv, noch Maltechnik auf einen Nenner zu bringen sind, über die Unterschiede hinweg die Hand. Im direkten Gegenüber entwickeln die menschenleeren, im Raumnebel versunkenen Dämmerstunden Leena Krügers und die sich in bonbonsüßer Farbigkeit auflösenden Dinglichkeiten in den Bildern von Ursula Krämer dialogische Potenz.
Die Farbnebelbilder der „Kleinen Lebenswelten“ von Leena Krüger, angesiedelt in einem in die Ferne weisenden Blaugrün, überfangen von verhaltenem Grauweiß, erzählen von Landschaften und Räumen, die nur mehr als schattenhafte Temperaturwerte in der Erinnerung haften geblieben sind. Längst vergessen ist der genaue Ort, unwichtig jede konkretisierbare Raumstruktur. Dem dünnen, zeichnerisch agierenden schwarzen Tuschestrich erst kommt die Aufgabe zu, die dunstumfangenen Schwebezustände, in denen Farbschichtungen ein Spiel aus Licht und Schatten entwerfen, Bildern anzuverwandeln, die ein verortbares Oben und Unten erhalten. Vielleicht eine Türöffnung, ein mit der Zeit matt und undurchsichtig gewordenes Fenster, die Landschaft durchkreuzende Oberleitungen, verschwommene Zuggleise oder feucht glänzender Straßenasphalt: an den Linienkonstruktionen hält sich der orientierungslose Blick wie an dem Geländer eines Treppenhauses fest. „Systeme für sich“ sind kein Objekt, kein konkreter Raum, lediglich die in ihnen angelegte Ahnung von Räumlichkeit gibt dem Blick in die Ferne etwas Halt in gefühlter Unendlich- und Zeitlosigkeit.
Nah, zu nah dagegen kommt der Pinsel von Ursula Krämer bekannten, leicht definierbaren Objekten. Mit bewusst eingesetzter malerischer Distanzlosigkeit, kombiniert mit einer beachtlichen Portion farblicher Respektlosigkeit, wird der Kampf gegen die Übermacht der durch Umriss und Eigenfarbigkeit klar definierten Dinge aufgenommen. Radikal an- oder auch ausgeschnittene Objekte, so nah herangeholt, dass sich ihr Gegenstandcharakter zunehmend verflüchtigt, werden im Spiel ihrer Farbflächen – wenn auch nur für den Moment eines Bildes – von ihrer funktionalen Eingebundenheit befreit. Sukzessiv wird die geordnete Objektwelt in einen Flickenteppich aus Farbflecken verwandelt. Sie findet sich in einem ornamentalen Farbstrudel wieder, in dem sich das bis dato Festgefügte vor den Blicken des Betrachters verflüssigt. Uneingeschränkt schafft sich Ursula Krämer mit jeder Annäherung ihres Pinselstrichs an das Objekt die Möglichkeit, angesichts einer allzu klar konturierten Überfülle der Alltagsobjekte zu neuen, ungeahnt überraschenden Strukturbildungen zu finden. Nah und doch zugleich unendlich weit entfernt vom funktionalen Ding. Bilder voll vom Aufatmen im unkonkreten Raum, sind sie Ruhezonen, angesiedelt irgendwo zwischen klar definierten Aggregatzuständen: Möglichkeiten zwischen zuviel Wirklichkeit.
Das „zu Nah, um den Objektumriss noch klar zu erkennen und zu benennen“ in den Werken von Ursula Krämer und das „zu Fern, um noch genau die Konturen und Eigenheiten der gewählten Konstruktionen zu erkennen“ von Leena Krüger weisen in dieselbe Richtung. Ein um das andere Mal fragen sie nach Methode, Funktionalität, Sinn und Unsinn des ordnenden Eingriffs in Farbenspiel und Formgestalten durch Kontur- und Raumlinien, mit dem der Wahrnehmung tagtäglich Landschaften, Architekturen, Menschen oder Dinge als klar verortbare, fest umrissene Ganzheit angeboten werden. Ein um das andere Mal berichten sie – wenn auch aus ganz unterschiedlichen malerischen Positionen heraus – von der Freiheit, die sich einstellt, wenn diese Einordnungsfunktion als konstruktives Element im eigenen Tun und nicht als fest gefügter Parameter von außen erkannt und genutzt wird.
–
Anja Marrack, Kunsthistorikerin